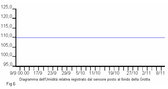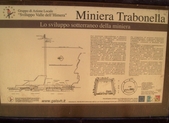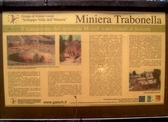Lavagrotten am Ätna
Während unserer diesjährigen geologischen Exkursion nach Sizilien haben wir, Timm und Rainer, am 25. Juni 2007 eine Wanderung zu 6 Lavagrotten unternommen, über die wir im Folgenden mit wenig Text, dafür aber mit vielen Bildern berichten möchten.
Der Club Alpino Italiano (CAI) - Sezione dell'Etna - Gruppo Grotte Catania listet auf seiner Homepage www.caicatania.it 214 bekannte Lavagrotten am Ätna auf.
Es wird unterschieden in Grotten, die eine unmittelbare Folge der Eruption sind und in solche, die sekundär entstanden sind. Eruptionsgrotten können aus explosiven Bocchen, aus effusiven Bocchen oder aus dem fließenden Lavastrom entstehen. Als sekundäre Grotten sind spätere Bildungen durch die Kraft des fließenden Wassers, durch Windausblasungen, hier meist in losen Tuffen und Aschen, und durch die Einwirkung des Menschen zu nennen.
Die meisten Grotten oder auch Lavatunnel des Ätna sind aus der fließenden Lava entstanden. Ein Lavatunnel entsteht, wenn sich ein zu Tal fließender Lavastrom an seiner Außenseite durch die Luft abkühlt, die Lava im Inneren des Stroms aber keinen Kontakt zur kühlenden Außenluft hat und so ihre hohe Temperatur von etwa 1.000 °C beibehält. Die Lava im Inneren der verfestigten und isolierenden Kruste fließt weiter und wenn keine neue Lava nachkommt, leert sich der Innenraum und es bleibt ein Hohlraum zurück.
Geht man vom Rifugio Brunek (im Pineta Ragabo an der Via Mareneve gelegen - das ist die Verbindungsstraße Linguaglossa - Piano Provenzana) in nördliche Richtung bergabwärts quer durch den lichten Kiefernwald, so erreicht man nach kaum 200 m ein Hinweisschild zur Grotta di Corruccio. Direkt am Weg davor fällt ein schwarzer Lavakegel auf, der Monte Corruccio, der vermuten lässt, dass dies die Ausbruchstelle der die Grotte bildenden Lava ist. Es handelt sich also um eine Grotte, die durch eine effusive Eruption unmittelbar an der Ausbruchstelle entstanden ist.
Dem Hinweisschild folgend erreicht man die beiden Eingänge zur Grotte. Nach Norden den Hang hinunter schließt sich ein verfallener Lavatunnel an, dessen Decke eingestürzt ist. Er sieht aus wie ein zu beiden Seiten durch Mauern eingefriedeter Bereich und wurde deshalb auch als Ziegenpferch genutzt.
Von hier aus hat man bei klarem Wetter einen herrlichen Blick auf den zum Meer abfallenden Bergrücken mit der Stadt Taormina und rechts davon Calabrien.
Steigt man nun zum Rifugio Brunek zurück und nimmt den oberen Waldweg, biegt nach knapp 2 km vor der Caserma Pitarrone, einer verlassenen Forsthütte, links ab, so erreicht man nach kurzer Strecke den imposanten Lavazug von 2002. Wie ein unaufhaltsamer Fluss schneidet die Lava den Berg herab durch den Hochwald. Kein Wunder, dass Michele, der Wirt des Rifugio Brunek, damals Stoßgebete zur heiligen Maria geschickt hat, dass sie ihn und seine Hütte verschone.
Auf dem weiteren Weg quert man nacheinander die Laven aus den Jahren 1923, 1911 und 1879. Mit einiger Übung kann man das ungefähre Alter der Laven am Verwitterungsgrad und vor allem am Bewuchs erkennen. Als typische Pionierpflanze, die als erste auch auf grober Asche wächst, gilt das Seifenkraut (saponaria sicula), in dessen Kolonien sich sukzessiv andere Pflanzen ansiedeln und nach und nach Boden bilden.
In der Lava von 1911 liegen links des Wegs ihre imposanten Förderapparate. Hier hat die Lava in einer breiten Schlucht hohe und steile Wände gebildet. Es ist sehr empfehlenswert, die etwa 200 m bis zu den Bocchen hinein zugehen.
Nach weiteren etwa 4 km nimmt man an einer Weggabelung den rechten absteigenden Weg zur Grotta delle Palombe. Hier gibt es eine Forsthütte, der gesamte Bereich ist eingezäunt, aber zugänglich. Um das senkrechte und tiefe Einstiegsloch zur Grotte gibt es einen weiteren Holzzaun. In die Grotte hinein kommt man nur durch Abseilen.
Steigt man den Weg hoch zurück zur Weggabelung und hält sich rechts, erreicht man nach etwa 500 m rechts unterhalb des Forstwegs die kleine Grotta delle Femmine. Die Grotte hat nur ein winziges Einstiegsloch und ist weder einsehbar noch begehbar.
Auf dem weiteren leicht ansteigenden Weg passieren wir einen lichten Mischwald, der auf uralter Lava wächst.
Nach kurzer Strecke erreichen wir die Lava von 1947, sofort erkennbar an ihrer unverwitterten dunklen Färbung und dem fehlenden Bewuchs. Immer wieder faszinierend sind die abrupten Übergänge zwischen der dunklen nackten Lava und der üppigen grünen Vegetation.
Hier endet der Wald und wir queren den Lavastrom. Linker Hand in der Ferne grüßt der kahle Gipfel des Monte Nero.
Plötzlich wechseln Form und Farbe der Lava, auf die blockige Aa-Lava folgt mit scharfem Übergang die Pahoehoe-Lava dell Passo Dammusi. Diese formenreiche Lava ist in den Jahren 1914 bis 1924 ausgeflossen. Der laterale überwiegend effusive Ausbruch war nach Norden und Nordosten gerichtet und hatte ein ausgedehntes Lavafeld zur Folge.
Die Lava stellt sich in geradezu künstlerischen Formen dar, es gibt glatte Oberflächen, Kissen und kunstvoll gelegte Stricke und Wülste. Immer wieder treffen wir auf neuen Formenreichtum.
An einer Weggabelung nach weiteren etwa 1,5 km - scharf links geht es zum Monte Santa Maria und zum Monte Nero, rechts zum Monte Spagnolo - machen wir in der größten Mittagshitze eine kurze Pause. Schatten gibt es hier nirgendwo.
Wir steigen nach Süden durch die Pahoehoe-Lava den Berg hinauf und suchen die Grotta dei Lamponi. Da es hier mehrere Grotteneingänge gibt, die alle dem selben Tunnelsystem angehören, dauert es eine gewisse Zeit, bis wir den Grotteneingang in 1.762 Höhe ü. NN gefunden haben.
Der Lavatunnel der Grotta dei Lamponi verläuft radial auf den Gipfel des Ätna zu. Seine Länge soll insgesamt 400 m erreichen, der Durchmesser beträgt 5 bis 10 m. In der Grotte wird es mit zunehmender Entfernung zum Eingangsloch so dunkel, dass unsere Taschenlampen ihren Dienst versagen. Nur der Blitz unserer Camera lässt den Verlauf der Höhle erkennen.
Typisch für einen Lavatunnel sind der sanfte Schwung seines Verlaufs, der leicht elliptische Querschnitt, die durch die fließende Lava verursachten so genannten Strandlinien an den Seitenwänden und die Andeutung kleiner Stalaktiten an der Höhlendecke.
Jetzt beginnt der anstrengende Aufstieg zur etwa 2.045 m ü. NN gelegenen Grotta del Gelo, wir müssen dazu 300 Höhenmeter bei 32 °C im Schatten überwinden. Aber Schatten gibt es auf der ganzen Strecke nicht.
Der Aufstieg führt etwa 4 km durch die immer wieder durch ihre Formenvielfalt überraschende Pahoehoe-Lava des lang andauernden Ausbruchs von 1914 bis 1924. Die Fotos zeigen eine kleine Auswahl dieser natürlichen Kunstwerke.
Der durch Steinmännchen markierte schmale Aufstieg führt durch eine Dagala (von Lava umflossene Vegetationsinsel), die wie eine grüne Oase inmitten der Steinwüste Leben spendet. Hin und wieder eröffnet sich ein atemberaubender Blick in das Tal des Alcantara und auf die dort gelegene Stadt Randazzo. Die in der Ferne verblassenden Berge Siziliens liegen schon weit unter uns.
Durch Zufall entdecken wir neben der markierten Strecke, wir befinden uns bereits auf über 2.000 Höhenmetern, eine kleine Grotte mit senkrechtem Eingangsloch, aus der eiskalte Luft entweicht. Als wir uns die Sache näher ansehen, erkennen wir, dass sich die Grotte in der Tiefe erweitert und dass sie dort mit Eis gefüllt ist. Am Grottenrand gibt es einen Platz, von dem wir unsere Beine in die Tiefe hängen und die erfrischende Kühle genießen können. Wir können uns von diesem komfortablen Platz nicht lösen, auch in mehr als 2.000 m Höhe messen wir noch 30 °C.
Wir bewegen uns nun auf einer Hochebene. Die Lava ist hier in großen Platten gebrochen und aufgeschoben, es sieht aus, als ob die Betonplatten einer Autobahn aufgebrochen seien.
Endlich, der Weg zieht sich länger hin als vermutet, erreichen wir die Grotta del Gelo. Der Name bedeutet Frostgrotte, und in der Tat steckt hinter einer unscheinbaren Einstiegsöffnung eine kleine Eis-Wunderwelt, die oft als der südlichste Gletscher Europas bezeichnet wird.
Obwohl draußen die Mittagshitze 30 °C im Schatten erreicht, ist es in der Höhle eiskalt. Eine tolle Erfrischung nach der Gluthitze des Aufstiegs. Doch die Hitze macht sich auch bereits in der Grotte bemerkbar, denn die Eisgebilde sind dabei, abzuschmelzen. Überall tropft und gluckert es. Die Temperatur in der Grotte steigt im Sommer jedoch selten über 0 °C und liegt im Winter bei etwa -4 bis -5 °C. Die Luftfeuchtigkeit ist das ganze Jahr über weitgehend konstant.
Gegen 15 Uhr machen wir uns auf den langen Rückweg zum Rifugio Brunek.
Der Gipfelbereich des Ätna 2007
Im Juni 2007 war die Aktivität auf der Kraterterrasse - bis auf starke Dampf- und Gasbildungen - recht moderat. Die Ende 2006 und Anfang 2007 beobachteten Lavaeffusionen im Gipfelbereich beschränkten sich auf den Südost-Krater, dessen Ostflanke dadurch stark in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Der atemberaubende Gipfelbereich des Ätna ist immer wieder ein überwältigendes Erlebnis. Im Exkursionsbericht von 2004 Aufstieg zur Kraterterrasse haben wir den Gipfelbereich ausführlich beschrieben. Im Folgenden wollen wir die Bilder sprechen lassen.
Die Kraterterrasse stellt die aufgefüllte Öffnung des Zentralkegels bzw. - kraters dar, der mit einer Höhe von rund 400 m und einem Basisdurchmesser von 1,5 km seit mindestens 250 Jahren in nahezu dieser Gestalt den Gipfel des Ätna und sein eruptives Zentrum bildet.
Innerhalb dieses Zentralkegels haben sich im Lauf der Zeit zwei separate Krater gebildet, die Bocca Nuova im Westen und die Voragine, auch Cratere Zentrale genannt, im Osten. Separat von der Kraterterrasse gelegen sind der Nordostkrater und der zur Zeit aktive Südostkrater.
Den Gipfelbereich des Ätna kreuzt ein tektonisch vorgezeichnetes aktives System parallel verlaufender Eruptionsspalten. Dieses Störungssystem setzt sich in der so genannten Süd-Riftzone nach Süden und tiefer am Berg nach Südwesten bis zum Ort Nicolosi fort. Als Nordost-Riftzone verläuft es vom Gipfelbereich nach Norden und Nordosten und endet erst nördlich des Monte Rosso in 1.650 m Geländehöhe.
Entlang dieses etwa 23 km langen und 2-3 km breiten Störungssystems haben sich in historischer Zeit bevorzugt Flankenausbrüche ereignet und ereignen sich auch heute.
Interessant ist, dass sowohl die Touristenstation Ätna-Süd als auch die Touristenstation Ätna-Nord (Piano Provenzana) im Bereich dieses Störungssystems liegen.
Viele der Ausbrüche in letzter Zeit waren an dieses System gebunden. So z.B. der heftige Ausbruch von 1983, der die Station Ätna-Süd, die Seilbahn und die südliche Auffahrtstraße zum größten Teil zerstörte. Ebenfalls die Ausbrüche von 2001 und 2002, die mit der teilweisen Zerstörung von Ätna-Süd und der Seilbahn endeten.
Der Ausbruch von 2002 fand sowohl an der Südflanke als auch an der Nordostflanke statt, wo er zur völligen Einebnung des Piano Provenzana (Ätna-Nord) mit seinen zwei Albergos, seinen Skihütten und Souvenirläden führte.
Schwefelbergwerke auf Sizilien
Sizilien verdankt den reichen Schwefelvorkommen im Dreieck Sciacca-Enna-Gela eine gewisse bergbauliche Berühmtheit. Bereits in der Antike wurde hier Schwefel gewonnen. Während im Mittelalter Schwefel hauptsächlich zur Herstellung von Schießpulver benötigt wurde, gewann seit dem 19. Jahrhundert in den Industriestaaten die Herstellung von Schwefelsäure an Bedeutung.
Die Anfänge des industriellen Schwefelbergbaus in Sizilien werden auf das Jahr 1736 datiert. 1901 waren in Sizilien 886 Schwefelgruben in Betrieb, die meist im Tagebau betrieben wurden. Hier schufteten 38.000 Bergleute und gewannen 3,4 Millionen Tonnen Fördergut, aus dem schließlich 0,54 Millionen Tonnen reinen Schwefels gewonnen wurde. Das waren damals immerhin 95,5% der gesamten Weltproduktion.
Anfang des 19. Jahrhunderts setzte jedoch vor allem wegen der zunehmenden billigen Konkurrenz aus den USA ein Rückgang der Förderung ein. Bereits 1917 war der Anteil Italiens an der Weltproduktion auf 14 % gefallen, 1965 waren noch 180 Bergwerke in Betrieb, 1978 gab es nur noch 9 Schwefelgruben. 1987 war Cozzodisi das letzte betriebene Bergwerk . Heute gibt es kein einziges in Betrieb befindliches Schwefelbergwerk in Sizilien mehr.
Die Schwefelvorkommen in Zentralsizilien sind sedimentärer Entstehung. Durch starke Absenkungen bildete sich ab dem Miozän das etwa 140 km lange und etwa 80 km breite zentralsizilianische Becken, in dem bis in das Pleistozän eine 8.000 m mächtige Sedimentabfolge abgelagert wurde.
Der wichtigste Teil der Beckenfüllung ist die Schwefel-Gips-Serie, die vor 7,5 bis 5 Millionen Jahren entstand, als durch die Schließung der Meerenge von Gilbraltar das Mittelmeeer von den Weltmeeren abgeschnürt und das gesamte Wasser des Beckeninhaltes mehrmals eingedampft wurde.
Miniera Trabonella
Östlich der alten Bergbau- Hauptstadt Caltanissetta liegt die kleine Ortschaft Villaggio Santa Barbara, an deren östlichem Ortsende eine kleine geteerte Straße in nordöstlicher Richtung zum ehemaligen Schwefelbergwerk Miniera Trabonella führt. An der Abzweigung steht noch ein alter Wegweiser.